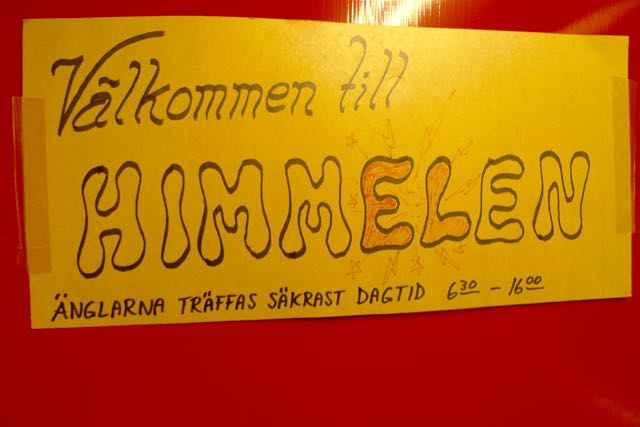Eine Betrachtung zur aktuellen Ausstellung im Bode Museum
Walter Benjamim:
Engel der Melancholie
Als Walter Benjamin (1892-1940) Ende Mai 1921 seinen Freund Gershom Scholem in der Münchener Türkenstraße 98 besuchte, war sein Leben in einer desolaten Situation. Noch immer war er finanziell abhängig von seinem Vater. Mit seiner Frau und gemeinsamem Kind wohnte er im Berliner Elternhaus, zog aus und kam als verlorener Sohn wieder zurück. Ihrem Kind hatte das junge Ehepaar den Namen des Erzengels Raphael gegeben. Aber Dora und Walter Benjamin ging es wie der unglücklichen Sara in der Tobit-Legende, bevor sie den für sie von ihrem Engel Erwählten begegnete: Über ihrem Bund lag kein Segen. Beide suchten Ablenkung in Affären. Benjamin hatte eine Beziehung zu der Bildhauerin Julia Cohn (1888-1941).
Wie Walter Benjamin, so kam auch Gershom Scholem (1897-1982) aus einem assimilierten Judentum. Sein Weg führte ihn „Von Berlin nach Jerusalem“ (1977). In seiner Jugend bewies er einen realistischen Blick auf die Lage der Juden in Deutschland wie ihn auch Walther Rathenau in seinen „Reflexionen“ (1912) in atemberaubender Klarheit formuliert hatte:
„Eine neue Romantik wird kommen: die Romantik der Rasse. Sie wird das reine Nordlandsblut verherrlichen und neue Begriffe von Tugend und Laster schaffen. Den Zug des Materialismus wird diese Romantik eine Weile hemmen. Dann wird sie vergehen, weil die Welt neben der blonden Gesinnung des schwarzen Geistes bedarf und weil das Dämonische sein Recht will. Aber die Spuren dieser letzten Romantik werden niemals schwinden.“
In München hatte der verzweifelte Walter Benjamin ein Schlüsselerlebnis. Er sah eine kleine Zeichnung aus Tusche und Ölkreide von Paul Klee, die ihm unter die Haut ging. In dem geflügelten Wesen mit Krallenfüßen, wirrem gelockten Haar, frei schwebend über allen Bindungen, glaubte er sich selbst wiederzuerkennen. Die seltsame Gestalt hatte den Mund geöffnet, als wollte sie etwas mitteilen. Aber sie schaute am Betrachter vorbei und vermied wie Walter Benjamin, wenn er sprach oder einen öffentlichen Vortrag hielt, den direkten Blickkontakt.
Walter Benjamin hatte damals alle Beziehungen zu Wegbegleitern und Freunden abgebrochen und viele von ihnen tief verletzt. Er selbst war belastet durch das Familienerbe einer großen Schwermut, die ihn immer wieder an seelische Grenzen und zu suizidalen Gedanken führte. Das seltsame Wesen auf dem Bild war ein Spiegel der Seele und ihrer tiefen Traurigkeit. War es ein Engel oder ein gefallener Engel? Paul Klee hatte das Wesen mit den Satansfüßen 1920 gemalt und ihm den Titel „Angelus Novus“ (31,8 × 24,2 Zentimeter) gegeben. In der Münchener Galerie Hans Goltz wurde es im Mai und Juni 1920 ausgestellt. Kunstgeschichtlich betrachtet, war der tragikomische Engel keine neue Erfindung. Schon Albrecht Dürer (1471-1528) hatte auf seinem Kupferstich „Melencolia I“ (1514) einen Engel der Schwermut gestochen. Der finnische Maler Hugo Simberg (1873-1917) setzte mit „Der verwundete Engel“ (1903) einen zarten weiblichen Engel mit verbundenen Augen und einem gebrochenen Flügel ins Bild. Er wird von zwei jungen Männern auf einer Tragbahre transportiert. Dieser Engel der Melancholie schützte nicht mehr den Menschen wie die großen Engel, die in Drucken tausendfach Trost und Zuversicht in deutschen Schlaf- und Kinderzimmern spendeten. Er war selbst schutzbedürftig wie Finnland unter der Okkupation durch Russland zur Zeit der Entstehung des Bildes. Engelbilder von Rang sind immer Chiffren.
Walter Benjamin erwarb das Bild im Vorfeld der kommenden Inflation für eintausend Papiermark. Er hinterließ es zuerst in der Münchener Wohnung des Freundes. Gershom Scholem, der Wiederentdecker der Kabbala, arbeitete damals über die Hymnen der Engel in den Vorstellungen jüdischer Mystiker. Am Tage singe Israel Hymnen, zitiert er den Talmud, in der Nacht singen die Engel. Benjamins Engel stimmt kein Lob der Schöpfung an. Inspiriert durch das Bild schrieb Scholem nach Berlin einen „Gruß vom Angelus“:
„Mein Flügel ist zum Schwung bereit
Ich kehrte gern zurück
Denn blieb’ ich auch lebendige Zeit
Ich hätte wenig Glück.“
Verse dieser Art wurden in Benjamins „Zentralblatt für Angelologie“ gesammelt. Der „Gruß vom Angelus“ enthält eine pessimistische Deutung der Geschichte. Sie wird Benjamin zu seinen berühmten Thesen „Über den Begriff der Geschichte“ (1940) inspirieren. Ende November 1921 hing der Engel der Melancholie bis zur Trennung von seiner Frau (1929) über dem Sofa in Benjamins Berliner Arbeitszimmer Delbrückstraße 23. Wegen der lettischen Schauspielerin Asja Lācis (1891-1979) hatte Benjamin seine Ehe gesprengt. Bald gingen sie getrennte Wege. Je mehr sich sein Leben in den Irrungen und Wirrungen alter Krisenmuster verstrickte, desto wichtiger wurde Benjamin das Bild. Als er sich Ende 1932 das Leben nehmen wollte, vermachte er den „Angelus Novus“ testamentarisch dem Freund. Der war bereits 1923 einem anderen Boten nach Palästina gefolgt. Nach dem Ausbruch des Weltkrieges schrieb ihm daher seine Mutter Betty Scholem aus dem australischen Exil: „Du hast ja doch Dein Leben richtig gezimmert und früh erkannt, welchen Weg die Entwicklung in Deutschland nehmen würde, was wir Alle nicht sehen wollten, und wofür wir ja nun auch schön in der Patsche sitzen.“ (6. November 1939)
Benjamin war nach der Machtergreifung erst auf die Insel Ibiza, dann nach Paris geflohen. Anlässlich seines Besuches im Jahr 1938 sieht Scholem Benjamins alter ego in seinem Zimmer in der Rue Dombasle 10. Im Juni 1940 flieht Benjamin aus Paris. Seine Manuskripte verpackt er in zwei Koffern, schneidet das Bild aus dem Rahmen und legt es dazu. Georges Bataille versteckt den Nachlass in Räumen der Bibliothèque Nationale. Später gelangt das Bild nach Amerika, kommt nach dem Krieg nach Deutschland zurück und findet den Weg zu Gershom Scholem und seiner Frau Fania. Heute gehört der „Angelus Novus“ dem Nationalmuseum Israels (Bestandsnummer B87.0994).
Jeder Engel birgt ein Geheimnis. Das gilt auch für Benjamins Engel. Immer wieder gab er der Zeichnung eine neue Bedeutung und umkreiste damit das Rätsel seines eigenen Lebens. Nach dem Scheitern seiner Habilitation, der Scheidung und der Flucht aus Deutschland verbrachte er den Sommer von Malaria geplagt auf Ibiza. Hier nimmt er in der Meditation „Agesilaus Santander“ den Gedanken der lobpreisenden Engel auf: „Die Kabbala erzählt, dass Gott in jedem Nu eine Unzahl neuer Engel schafft, die alle nur bestimmt sind, ehe sie in Nichts zergehen, einen Augenblick vor seinem Thron sein Lob zu singen. Meiner war dabei unterbrochen worden: seine Züge hatten nicht Menschenähnliches.“ Über den seltsamen Namen des Engels ist viel spekuliert worden. Benjamin hat ihn nicht entschlüsselt, gehörte Agesilaus Santander doch zu jenen zwei geheimen Vornamen, die er angeblich von seinen Eltern erhalten hatte. Ein Pseudonym oder Nom de plume, damit „nicht gleich jeder merke, dass ich Jude sei.“
In seinem Aufsatz „Die geheimen Namen Walter Benjjamins“ (1978) attestierte Gershom Scholem dem Freund mangelhafte Kenntnisse der jüdischen Überlieferung: „Aber Benjamin kannte sich in jüdischen Verhältnissen nicht sehr gut aus.“ Das Anagramm Agesilaus Santander glaubte er entschlüsseln zu können als „Der Angelus Satans“. So trüge der Engel der Geschichte die Züge Lucifers.
In Frankreich bewahrte den Freund nichts vor der Verfolgung. Er flüchtete über Lourdes und Marseille und erreichte mit anderen Flüchtlingen den katalonischen Grenzort Portbou. Seine Begleiter fanden einen Weg in die Freiheit. Der Engel der Melancholie aber hatte Benjamin vollständig in Besitz genommen. Mit einer Überdosis Morphiumtabletten setzte er seinem Leben im September 1940 ein Ende.
Zuvor hatte er seinen Engel zum Symbol der Geschichte des 20. Jahrhunderts erhoben. Gleich anderen Schriftstellern und Gelehrten spielte Benjamin in den Zwanziger Jahren mit marxistischen Utopien. Er unternahm eine Pilgerreise in die Sowjetunion. Wie Bertolt Brecht, den er mehrfach in seinem dänischen Exil besuchte, verschloss er die Augen vor der stalinistischen Wirklichkeit. Den Hitler-Stalin-Pakt erlebte er als Schock. So wurde aus dem Engel der Melancholie der ohnmächtige Engel der Geschichte. Er sieht „eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert.“ Nun ist die Rettung der Welt nicht Aufgabe der Engel, sondern des Messias. Nicht die Weltgeschichte spricht das letzte Urteil, sondern das Weltgericht. Das gilt auch für das Verhältnis von Juden und Palästinensern. Im Jahr 1981 wurde Gershom Scholem von einem Besucher gefragt, welche „Lösung des Palästinenserproblems“ er sehe. Die Antwort lautete: „Heute gibt es keine Lösung mehr.“